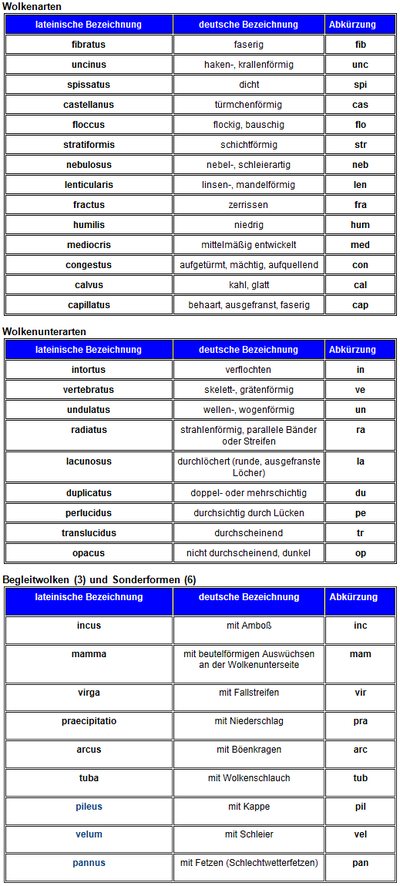19. Juli 2014 | M.Sc.-Met. Anna Wieczorek
Wolken und ihre Bezeichnungen
Am gestrigen Freitag kamen im Thema des Tages Begriffe wie Cirrus oder Stratocumulus zur Sprache. Diese Begriffe geben Wolkentypen an. Aber wonach klassifiziert man Wolken und was bedeutet das? Diese Frage soll im heutigen Thema des Tages beantwortet werden.
Zunächst soll erklärt werden, was eine Wolke ist bzw. wie sie
entsteht.
Wolken sind eine sichtbare Anhäufung von Wasserdampf, die aus
feinsten Wassertröpfchen oder Eiskristallen bestehen. Wolken
entstehen, wenn der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf an
sogenannten Kondensationskernen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 100% kondensiert und Wassertröpfchen bzw. durch Gefrieren
Eiskristalle bildet. Als Kondensationskerne bzw. -keime dienen
beispielsweise Salzpartikel oder Staub. Je nach genauem
Entstehungsprozess der Wolke und somit auch der Zusammensetzung der
Wolkenpartikel entstehen die unterschiedlichsten Erscheinungsformen
der Wolken.
Die erste Wolkenklassifikation wurde von dem englischen Pharmazeuten
und Hobbymeteorologen Luke Howard im Jahre 1803 erstellt. Er teilte
die Wolken in Anlehnung an die Biologie in Familien, Gattungen, Arten
und Unterarten ein. Seine Einteilung ist heute noch in der
verbesserten Klassifikation der WMO (World Meteorological
Organization) als internationale Klassifikation gebräuchlich und soll
im Folgenden kurz erläutert werden.
Grundsätzlich werden bei der Wolkenklassifikation das
Erscheinungsbild, die Form, Größe und Gestalt der Wolke und die
hervorgerufenen optischen Effekte wie Schatten oder
Lichtdurchlässigkeit mit einbezogen. Daraus ergeben sich 4
Wolkenfamilien, 10 Wolkengattungen, 14 Wolkenarten, 9
Wolkenunterarten und 9 Sonderformen und Begleitwolken.
Die Wolkenfamilien lassen sich durch die Wolkenhöhe ("Stockwerke";
die angegebenen Werte gelten für die mittleren Breiten) festlegen:
- tiefe Wolken in einer Höhe von 0 bis 2 km,
- mittelhohe Wolken in einer Höhe von 2 bis 7 km und
- hohe Wolken in einer Höhe 5 bis 13 km.
Wolken, die eine große vertikale Erstreckung besitzen und sich somit
über alle "Stockwerke" erstrecken, stellen die vierte Wolkenfamilie
dar.
Die Gattungen teilen in der Regel die Familien in zwei Formen auf:
haufenförmige Wolken (Cumulus) und schichtförmige Wolken (Stratus).
Die hohen Wolken besitzen eine weitere Gattung, die sogenannten
Schleierwolken (Cirrus), die vollständig aus Eiskristallen bestehen
und Kondensstreifen ähneln. Im tiefen "Stockwerk" existiert noch eine
Mischform aus Stratus und Cumulus (Stratocumulus), die prinzipiell
wie eine schichtförmige Wolke ausschaut, in der aber noch markante
Strukturen zu erkennen sind. Ist die Familie und Gattung der Wolke
bekannt, ergibt sich der Name bzw. die Bezeichnung der Wolke. Für die
tiefen Wolken gibt die Gattung den Namen vor. Bei hohen Wolken kommt
ein "Cirro-" vor die Gattungsbezeichnung, bei mittelhohen ein "Alto-"
und bei vertikal mächtigen Wolken ein "Nimbo-".
Die Wolkenart wird durch die Gestalt der Wolke bestimmt. So erhält
beispielsweise eine linsenförmige Wolke den Beinamen lenticularis
oder eine hakenförmige Wolke den Beinamen uncinus. Die Unterarten
klassifizieren die Wolken dann noch genauer, z. B. erhält eine Wolke,
die die Sonne besonders gut durchscheinen lässt, die Unterart
translucidus.
Am Ende soll noch ein Beispiel zur Veranschaulichung angeführt
werden. Die im Volksmund unter Schönwetterwolken bekannten Cumulus
sind tiefe Wolken. Je nach genauer Erscheinungsform erhalten sie den
Beinamen (Wolkenart):
- humilis: horizontale Erstreckung ist höher als die vertikale, also
breiter als hoch
- mediocris: mittelgroß
- congestus: vertikale Erstreckung ist höher als die horizontale,
also höher als breit
Beispielbilder aller Wolkenbezeichnungen lassen sich im
internationalen Wolkenatlas einsehen. Die deutsche Fassung ist unter
"Wolkenatlas" im Wetterlexikon unter http://www.dwd.de/lexikon verfügbar.
© Deutscher Wetterdienst
Themenarchiv:
25.04. - Tag des Baumes
24.04. - Endlich wieder Regen?!
23.04. - Ein Käffchen geht immer
22.04. - Die Gewittersaison ist gestartet
21.04. - Die Gewitterlage am Ostersonntag
20.04. - Knoblauch: Der Wetterflüsterer im Beet
19.04. - Bicycle day
18.04. - Gewitterprognose im Warndienst des DWD
17.04. - Niederschlagsbilanz
16.04. - Starker Temperaturkontrast mit Folgen
15.04. - Große Wetter- und Temperaturkontraste über Deutschland
14.04. - Niederschläge auf der Alpensüdseite
13.04. - Endlich Regen – aber Vorhersage mit Tücken
12.04. - Das neue Naturgefahrenportal (NGP) des Deutschen Wetterdienstes
11.04. - Der Wind, der Wind, …
10.04. - Sonnige Aussichten
09.04. - Erster Sommertag am Wochenende?
08.04. - Wichtige Links auf der Homepage
07.04. - Temperatursturz par excellence: Lappland wärmer als Leipzig?
06.04. - Auf der Suche nach dem Regen
05.04. - Zunehmende Trockenheit und ihre Auswirkungen
04.04. - Unwetter auf den Kanaren
03.04. - Auf Frühlingswärme folgt Temperatursturz
02.04. - Deutschlandwetter im März 2025
31.03. - Wettercasts
30.03. - Hagelstürme in Europa
29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver
28.03. - Neues satellitengebundenes Blitzmesssystem hilfreich für Wetterwarnungen?
27.03. - Phantastische Atmosphärenmuster und wo sie zu finden sind