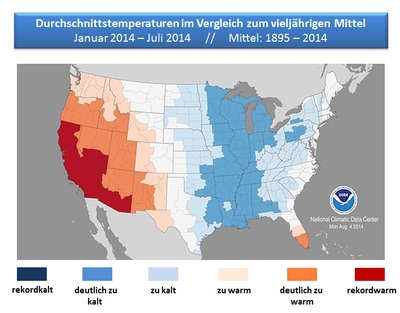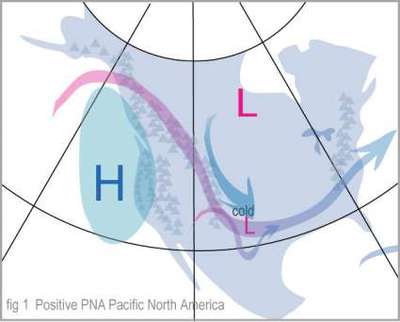09. September 2014 | Dipl.-Met. Adrian Leyser
USA 2014: Das Jahr der Extreme
Anfang September wurde im Thema des Tages und auch über eine offizielle Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes wie gewohnt ein Rückblick auf den vergangenen meteorologischen Sommer (Juni bis August) gegeben.
"Anfangs sehr warm, später deutliche Abkühlung" und "Zu Beginn trocken und warm - dann viele heftige Gewitter und nass", hieß es in der DWD-Mitteilung. Diese prägnanten Schlagzeilen sind durchaus sinnvoll und auch im Sinne einer fachlich korrekten und vollständigen Bewertung der Geschehnisse, wenn sich Wetterextreme (hier Temperatur und Niederschlag) zu einem dem vieljährigen Mittelwert nahezu entsprechenden Durchschnitt nivellieren. War das Wetter bezüglich des Mittelwertes wirklich immer und überall "normal", oder resultiert der Durchschnittswert aus einer räumlichen und/oder zeitlichen Aneinanderreihung gegensätzlicher Extreme? Folgendes Beispiel zeigt, von welcher fundamentalen Bedeutung es ist, neben der Bildung von räumlichen und zeitlichen Durchschnittswerten auch stets deren Zustandekommen zu hinterfragen.
It's the 1st time this century we've seen so much ice on the Great Lakes. More:
http://t.co/Jv0fdlhSHB pic.twitter.com/27nKh4ixM8
— The Weather Channel (@weatherchannel) 8. Februar 2014
Wir wollen nun über den "großen Teich" nach Nordamerika reisen. Vor
allem hinsichtlich der Temperatur erlebten die Vereinigten Staaten
von Amerika bis jetzt ein Jahr der Extreme und Rekorde. Richtet man
den Blick auf die Sommermonate, dann ergab sich folgendes Bild:
einige Städte im Nordwesten der USA verzeichneten den wärmsten Sommer
seit Aufzeichnungsbeginn. Der Beginn der Wetteraufzeichnungen liegt
wohlgemerkt vielfach über 100 Jahre zurück. Oft liegen die positiven
Abweichungen vom vieljährigen Mittel bei 3 Grad, mit Spitzenwerten um
4 Grad (zum Vergleich: der deutsche Rekordsommer von 2003 kam auf
eine Abweichung von 3,3 Grad). Von den größten Anomalien betroffen
sind besonders die Pazifikstaaten Kalifornien, Oregon und Washington.
In Medford (Oregon) beispielsweise wurde ein Temperaturmittel von
23,8 Grad Celsius registriert und der alte Rekord von 1967 damit
gleich um 0,6 Grad übertroffen. So oder so ähnlich sieht es in vielen
Städten der oben erwähnten US-Staaten aus. Zeitgleich geht der Sommer
in den meisten anderen US-Staaten als eher kühler, im Umfeld der
"Great Lakes" und in den Staaten der nördlichen "Great Plains" sogar
als rekordverdächtig kalter und zudem auch nasser in die
Geschichtsbücher ein. Einige Großstädte warten dort immer noch - und
in diesem Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch
vergeblich - auf Temperaturen über der 90-Grad-Fahrenheit-Marke
(entspricht etwa 32 Grad Celsius). Diese Tatsache ist als durchaus
bemerkenswert einzustufen, gibt es doch über dem nordamerikanischen
Kontinent sonst regelmäßig Hitzewellen, die bis weit in den Norden
vorstoßen. Chicago erreichte diese Marke nur dreimal in diesem
Sommer, wobei ganze siebzehn Tage mit Temperaturen über 32 Grad
Celsius statistisch gesehen zu erwarten sind.
Betrachtet man nun den Zeitraum von Januar 2014 bis Juli 2014, findet
sich eine vergleichbare Verteilung der Temperaturextrema (siehe dazu
die Abbildung der Abweichungen der Durchschnittstemperaturen). Erstaunlich und laut Klimaportal der NASA absolut
beispiellos ist das gleichzeitige Auftreten von rekordverdächtig
warmen und rekordverdächtig kalten Regionen über diesem
vergleichsweise langen Zeitraum. Nahezu die gesamte Westhälfte der
USA weist deutlich zu hohe Durchschnittstemperaturen für diesen
Jahresabschnitt auf. Von Kalifornien über Nevada bis nach Arizona
purzelten sogar häufig entsprechende Rekorde. Dem gegenüber steht
eine zu kalte Osthälfte (mit Ausnahme von Südflorida und einigen
küstennahen Regionen), wo vor allem in einem Streifen von den "Great
Lakes" bis an den Golf von Mexiko besonders hohe negative
Abweichungen der Durchschnittstemperaturen vom vieljährigen Mittel
auftraten.
Als mögliche Ursache für diese Kontraste wird ein nahezu stationäres
und im Wesentlichen seit Dezember letzten Jahres in Erscheinung
tretendes Hochdruckgebiet über dem Ostpazifik genannt. Zwischen
diesem Hoch und einem Tief, das sich weiter östlich über einen langen
Zeitraum etablieren konnte, stellte sich über weite Strecken eine
nördliche Strömung ein. Damit konnte über den zentralen und östlichen
Gebieten der USA einerseits in den Wintermonaten kalte Luft aus hohen
Breiten angezapft und bis weit nach Süden verfrachtet werden.
Andererseits wurden im Sommer Warmluftvorstöße nach Norden
weitestgehend unterbunden. Dagegen konnten sich die Luftmassen im
Westen der USA insbesondere in den Sommermonaten unter dauerhaftem
Hochdruckeinfluss besonders stark erwärmen.
Auch wenn es sich hierbei um ein "Extrembeispiel" handelt, zeigt es
doch, dass Durchschnitte, Mittelwerte u. Ä. nur statistische
Werkzeuge sind, die mit Vorsicht und vor allem nicht ohne
zusätzlichen Kommentar zu genießen sind. Man stelle sich vor, es
lägen im genannten Fall nur über die gesamte Fläche der Vereinigten
Staaten gemittelte Werte zur Verfügung. So würde ein dem vieljährigen
Mittel nahezu entsprechender Wert herauskommen. Daher bedarf es zur
vollständigen Bewertung der meteorologischen Bedingungen eines
genaueren Studiums.
© Deutscher Wetterdienst
Themenarchiv:
02.04. - Deutschlandwetter im März 2025
31.03. - Wettercasts
30.03. - Hagelstürme in Europa
29.03. - Gekonntes Täuschungsmanöver
28.03. - Neues satellitengebundenes Blitzmesssystem hilfreich für Wetterwarnungen?
27.03. - Phantastische Atmosphärenmuster und wo sie zu finden sind
26.03. - Das Wetter zur partiellen Sonnenfinsternis
25.03. - Rekordverdächtiger US-Tornado-Outbreak vom 14. bis 16.03.2025
24.03. - Erste Frühlingsgewitter samt lokalem Starkregen
23.03. - Der Welttag der Meteorologie 2025
22.03. - Übergang zu wechselhaftem Frühlingswetter
21.03. - Hält die Niederschlagsarmut an?
20.03. - Frühlingshaftes Hochdruckwetter, aber…
19.03. - Wenn die Müdigkeit im Frühjahr zuschlägt
18.03. - Die Zeichen stehen auf Frühling
17.03. - Hey JUDE!
16.03. - St. Patrick‘s Day
15.03. - Extreme Wetterbedingungen in den USA
14.03. - Tag der Mathematik
13.03. - Phänomen Nebel - Teil 4: Optische Nebelerscheinungen und Nebelauflösung
12.03. - Niederschläge hierzulande und weltweit
11.03. - An der Schwelle zum Erstfrühling
10.03. - Waldbrandbekämpfung macht erfinderisch
09.03. - Das Ende des Hochdruckwetters
08.03. - Die Bise zu Karneval
07.03. - Taschentuchsaison
06.03. - Große Tagesgänge - Vom Winter in den Frühling in wenigen Stunden
05.03. - Rossby-Wellen: Die harmonische Interaktion planetarer Kräfte
04.03. - Vertreibung des Winters?!