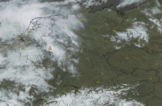√úber das Wettergeschehen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind wir Europ√§er f√ľr gew√∂hnlich medial sehr gut informiert. Egal ob extreme Niederschl√§ge im Mittelmeerraum, ein Orkan √ľber Nordwesteuropa oder heftige Schneef√§lle √ľber Skandinavien ‚Äď man bekommt hierzulande eine Vielzahl an Berichten und Bildern dazu ‚Äěserviert‚Äú bzw. kann sich diese einfach und rasch besorgen. Selbst die Wettervorg√§nge in den Vereinigten Staaten sind h√§ufig Bestandteil der hiesigen Berichterstattung. Fixstarter daf√ľr ist fast jeder Hurrikan sowie der eine oder andere st√§rkere Tornadooutbreak. Nun liegt Washington, D.C. bekanntlich etwa 6700 km Luftlinie von unserer Hauptstadt Berlin in westlicher Richtung entfernt ‚Äď wissen Sie aber auch so gut Bescheid √ľber die meteorologischen Vorg√§nge in einem √§hnlich weit entfernten Gebiet in Richtung Osten? Die Luftlinie zur Hauptstadt der Mongolei (Ulaanbaatar) ist mit knapp 6200 km sogar k√ľrzer als nach Washington, aber das dortige meteorologische Geschehen ist f√ľr uns Mitteleurop√§er doch eine ganz ‚Äěandere Welt‚Äú.
Die Mongolei liegt im Bereich des zentralasiatischen Hochlandes und bildet zwischen der Russischen F√∂deration und der Volkrepublik China einen sehr d√ľnn besiedelten Binnenstaat, wobei 40 % der Gesamtbev√∂lkerung (etwa drei Millionen) in der Hauptstadt wohnen. Die geographische Lage bringt mit sich, dass das Klima sehr kontinental gepr√§gt ist. Pr√§gend sind dabei eine gro√üe Schwankungsbreite der monatlichen Durchschnittstemperaturen (hei√üe Sommer, sehr kalte Winter) und der meist geringe Niederschlag (im Jahresverlauf ungleich verteilt). Die Folge davon sind ausgedehnte Steppengebiete, die im S√ľden in die W√ľste Gobi √ľbergehen.
Die oft nomadisch lebende Landbev√∂lkerung muss damit sowohl mit den landschaftlichen, als auch den klimatologischen Randbedingungen ihr Leben bestreiten. Dazu gesellen sich aber immer h√§ufiger Extremwetterereignisse, die meist zu viel Not und Leid f√ľhren. Ein solches wiederkehrendes Ereignis ist f√ľr die Region so pr√§gend, dass es einen eigenen Namen bekommen hat: Dsud (andere Schreibweise: Dzud, engl: zud). Dieser Begriff beschreibt au√üergew√∂hnlich harte Winterbedingungen, die zwischen Oktober und Mai auftreten und zu fehlenden Weidem√∂glichkeiten f√ľhren k√∂nnen. Die Tiere der Nomaden werden dabei von Tag zu Tag schw√§cher und sterben zwangsl√§ufig an Ersch√∂pfung, Verhungern oder durch Erfrieren. Nicht selten kommt es dabei zu einem Massensterben.
Allerdings gibt es mehrere Auspr√§gungen des Dsud. Beim sogenannten ‚ÄěWei√üen Dsud‚Äú f√§llt so viel Schnee, dass die Tiere nicht mehr an das Steppengras herankommen k√∂nnen. Besonders erschwerend kann dabei der Windeinfluss sein, der die Schneeoberfl√§che verdichtet. Betrifft dieses Ereignis nur eine kleine Region, k√∂nnen die Hirtenfamilien mit den Tieren noch in ein anderes Gebiet ziehen. Ein gro√üfl√§chiges Auftreten von gro√üen Schneemengen kann demgegen√ľber aber zu sehr schwerwiegenden Folgen f√ľhren. Ebenfalls gef√ľrchtet ist der ‚ÄěEis-Dsud‚Äú, bei dem die (Schnee-) Oberfl√§che von einer Eisschicht √ľberzogen wird. Dies passiert einerseits durch einen Kaltlufteinbruch nach einer Schmelzperiode oder durch gefrierenden Regen. Doch auch der Mangel an Schnee kann zu Problemen f√ľhren: Beim schwarzen Dsud f√ľhrt die fehlende Isolation des Schnees zu einem Gefrieren der Wasserl√§ufe. Durch damit nicht mehr gew√§hrleistete Wasserversorgung k√∂nnen Mensch und Tier rasch in Not geraten. Der kalte Dsud ist dagegen klassisch durch sehr tiefe Temperaturen charakterisiert. Extrem niedrige Temperaturen und starker eisiger Wind hindern Tiere am Grasen. Zudem verbrauchen diese einen Gro√üteil ihrer Energie um ihre K√∂rperw√§rme aufrecht zu erhalten.
Besonders nachteilig wirken sich aber auch vorangehende, sehr trockene Sommer aus. Langanhaltende D√ľrre f√ľhrt schon vor dem Winter zu einer schlechten N√§hrstoffversorgung der Schafe und Ziegen, damit gehen diese mit einem nicht ausreichenden Gesundheitszustand in die kalte Jahreszeit. Au√üerdem hindert D√ľrre die Hirten bei der Anlegung von Futterreserven als Wintervorsorge. Zudem k√∂nnen auch √úberweidung (zu viele Tiere auf engem Raum) und nachfolgende Versteppung der Landschaft zu Problemen bei der Futterbeschaffung f√ľhren.
W√§hrend historisch gesehen etwa alle 10 Jahre ein Dsud auftrat, sanken die Abst√§nde in der letzten Zeit auf wenige Jahre, teils gab es mehrere solcher Extremwinter hintereinander. Wenn man bedenkt, dass Mensch und Tier etwa 5 bis 10 Jahre ben√∂tigen sich davon zu erholen, kann diese Entwicklung zu einer substantiellen Bedrohung der nomadischen Lebensweise f√ľhren. Beispielsweise waren nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF) im Winter 2023/24 √ľber 258.000 Menschen ‚Äď darunter √ľber 100.000 Kinder ‚Äď von den Auswirkungen des Dsud betroffen, da neben den landwirtschaftlichen Einschr√§nkungen auch die Stra√üen durch starken Schneefall blockiert wurden und Kinder keinen Zugang zu lebenswichtigen Gesundheits-, Ern√§hrungs-, Bildungs- und Sozialdiensten hatten. Die Anzahl der ums Leben gekommenen Tiere wird mit etwa 1,5 Millionen gesch√§tzt (staatlichen Notstandskommission). Zudem explodierten die Futterpreise mit gravierenden finanziellen Folgen f√ľr die Hirten.