Bereits Ende Januar 2012 floss mit östlicher Strömung kalte Festlandluft nach Deutschland. Verbreitet blieben die Höchstwerte unter dem Gefrierpunkt. Eistage an sich sind nichts Ungewöhnliches zu dieser Jahreszeit. Die an den folgenden Tagen gemessenen Temperaturen waren es dann aber schon.
Ein sehr intensives und umfangreiches Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem Nordwesten Russlands erstreckte sich über Skandinavien bis zu den Britischen Inseln und noch etwas weiter westlich auf den Atlantik. An seiner Südflanke strömte sibirische Arktikluft (Kürzel cA) nach Mitteleuropa. Um eine Luftmasse zu klassifizieren, wird typischerweise die Temperatur auf einer Druckfläche von 850 Hektopascal (hPa), etwa 1500 Meter Höhe, herangenommen. Die Luftmasse Anfang Februar 2012 zeichnete sich durch sehr tiefe Temperaturen und einen sehr geringen Wassergehalt aus. In 850 hPa lag die Temperatur über Deutschland vom 2. bis 7. Februar 2012 zeitweise zwischen -15 und -20 Grad, örtlich war die Luft sogar noch etwas kälter.
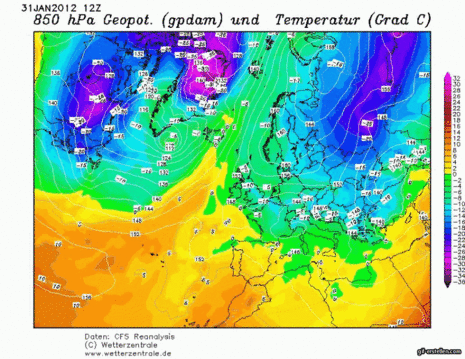

Nicht nur in der Höhe war es außerordentlich kalt, auch am Boden, besser gesagt in 2 Meter Höhe, wurden Werte gemessen, wie sie selten vorkommen. Besonders kalt waren der 6. und 7. Februar, wobei die tiefsten Werte jeweils im Osten und Süden Deutschlands registriert wurden. Am 6. Februar lag die Tiefsttemperatur verbreitet im strengen Frostbereich, nur am Niederrhein und auf manchen Nordseeinseln blieb es "wärmer" als -10 Grad. Sonst lag die Temperatur verbreitet zwischen -10 und -20 Grad, im Osten und Süden gebietsweise auch noch tiefer. Die kältesten Werte wurden am Morgen an der Station Ueckermünde in Vorpommern mit -28,7 Grad und in Oberstdorf am Alpenrand mit -29,4 Grad, gemessen. Die Höchsttemperatur lag zwar etwas höher, eisig blieb es aber auch am Tage. An der Station Berlin-Tempelhof war beispielsweise bei -10,5 Grad, an der Station Leipzig/Halle bei -13,6 Grad und in Augsburg bei -11,2 Grad Schluss mit der tageszeitlichen Erwärmung.
Die Folgenacht zum 07. Februar war dann in der Fläche noch kälter. Nur an wenigen Stationen auf den Nord- oder Ostseeinseln lagen die Tiefstwerte nicht unter -10 Grad. Selbst ansonsten recht milde Regionen Deutschlands rutschten tief in den strengen Frostbereich. Beispielhaft St. Peter-Ording an der Nordsee mit -16,8 Grad, Frankfurt/Main mit -15,8 Grad oder Köln-Bonn mit -17,6 Grad. Diese tiefen Werte sind umso erstaunlicher, da sie ohne das Vorhandensein einer Schneedecke zustande kamen. Eine Schneedecke verhilft, vor allem wenn die Schneedecke frisch ist, zu einer tieferen Temperatur aufgrund einer verbesserten langwelligen Ausstrahlung und ein Blockieren des Boden-Wärme-Stroms. Im Osten und Süden des Landes lag zwar gebietsweise eine, wenn auch dünne Schneedecke, die für sehr niedrige Minima sorgte. Doch auch abseits davon traten extrem niedrige Werte auf, mit dem negativen Spitzenreiter Baruth südlich von Berlin mit -23,7 Grad. Diese sogenannten Kahlfröste gehören zu den strengsten, die jemals in Deutschland aufgetreten sind. Als Folge drang der Frost bis 80 cm Tiefe in den Boden. Weitere Folgen waren zugefrorene Seen und Flüsse bzw. Eisgang auf den Flüssen. Auf der Alster in Hamburg erreichte die Eisdicke 15 bis 22 cm am 8. Februar. Dort konnte damit letztmalig das Alstereisvergnügen mit Buden auf der Alster stattfinden.
An den Folgetagen setzte sich die sehr kalte Witterung zunächst fort, erst ab dem 13. Februar kam es von Nordwesten her zu einer deutlichen Milderung. Vom 1. bis 12. Februar lag die Mitteltemperatur in Deutschland bei -10,3 Grad und damit streckenweise im Bereich strenger Winter wie 1963, 1956 oder 1929. Anders als in den genannten strengen Wintern war die Kälte 2012 zwar heftig, aber nicht so langanhaltend, bereits die Nacht zum 17. Februar war fast überall frostfrei und am 24. Februar wurden bei Mittenwald am Alpenrand sogar 17,3 Grad Plus gemessen.
Nicht nur in Deutschland war diese Kältewelle 2012 bemerkenswert. Weite Teile Europas wurden von der Kaltluft erreicht und verzeichneten ungewöhnlich tiefe Temperaturmesswerte. Über dem nördlichen Mittelmeerraum und Südosteuropa sorgte Tiefdruckaktivität zum Teil für Sturm in Orkanstärke und teils ergiebige Schneefälle.
Trotz der derzeit auf den ersten Blick ähnlichen Großwetterlage liegt die Temperatur aktuell auf einem ganz anderen Niveau als vor 13 Jahren. Der Grund ist, dass die Luftmasse nicht aus Sibirien, sondern aus Europa stammt. Anders als 2012 liegt zudem selbst in Osteuropa derzeit kaum Schnee. Dies sind schlechte Voraussetzungen für tiefe Temperaturen.







